Möhren |

Dolde der Wilden Möhre
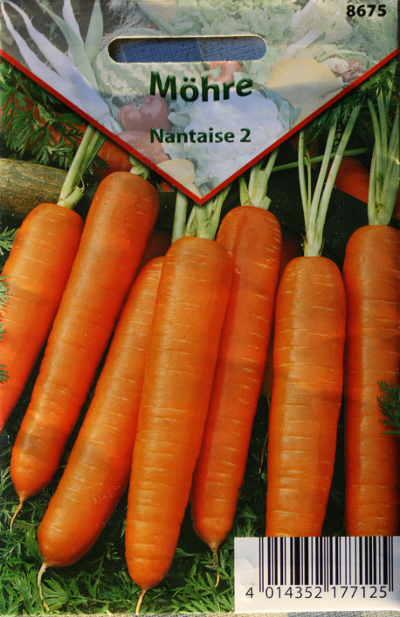
Kulturformen der Möhre sind in verschiedenen Sorten erhältlich
Eindeutig zuordnen lässt sich der Staphylinos des Dioskurides, bei dem es sich klar um die Wilde Möhre handelt, während Plinius Staphylinos einen scharfen Geschmack zuschreibt und ihn als wilde Pastinake bezeichnet. Das dürfte die Ursache dafür sein, dass im Kräuterbuch von Leonard Fuchs (1543) zwei Pflanzen, die wir heute als Möhren kennen, Pastinaken genannt werden und dass Bauhin in seiner Pinax (1623) die wilde Möhre als Pastinaca tenuifolia bezeichnete. Linné trennte 1753 endgültig die Gattungen Daucus und Pastinaca.
Die Etymologie von Daucus ist nicht geklärt, ebenso bestehen Zweifel an der Herkunft des Namens „Möhre" oder „Mohrrübe". Häufig wird die Ursache der Benennung auf die sich in der Mitte der Dolde befindliche schwarzviolette Blüte bezogen, die als „Mohrenblüte" bezeichnet wird.
Der Name „Karotte" entstand aus dem Artnamen Carota, einer lateinischen Bezeichnung für die Möhre, die auf das griechische Karoton zurückgeht. Es wird eine Ableitung von gr. Kar (Laus) vermutet, was sich auf die Form der Früchte beziehen soll. Auch die Bezeichnung Carum für Kümmel soll nach Meinung einiger Linguisten dort ihren Ursprung haben.
Die etwas über 20 Arten umfassende Gattung ist ursprünglich in Eurasien und Nordafrika beheimatet. Durch die Kultivierung der Gartenmöhre ist sie jedoch in allen gemäßigten Zonen der Welt zu finden. Es handelt sich um meist ein- bis zweijährige, krautige Pflanzen mit Pfahlwurzel. Die aufrechten oder seltener niederliegenden Stängel sind mehr oder weniger verzweigt und rau oder borstig behaart. Die 2- bis 3-fach gefiederten Blätter sind wechselständig oder in Scheinwirteln angeordnet. Die Fiederblättchen sind linealisch bis lanzettlich oder eiförmig und meist spitz. Die Blätter nehmen nach oben hin an Größe ab, wobei die unteren gestielt, die oberen sitzend sind. Die scheidigen Blattbasen umschließen den Stängel vollständig.
Der Blütenstand ist eine rand- und endständige Doppeldolde, selten sitzt er fast ungestielt in den Blattachseln. Tragblätter der Dolde, die sog. Hülle, fehlt oder besteht aus laubblattartigen, dreiteiligen oder gefiederten Blättern, die meist nach unten gerichtet sind. Die 4- bis 60-strahlige Dolde spaltet sich in Döldchen auf, die weiße, rosafarbene oder gelbe Blüten tragen. Ihre meist zahlreichen, gezähnten oder ganzrandigen Tragblätter bilden das Hüllchen. Die Kelchzähne sind unscheinbar oder seltener deutlich ausgebildet.
Die Blüten sind klein und zwittrig, ihre Kronblätter sind an der Spitze einwärts gebogen. Die randständigen Kronblätter sind mehr oder weniger vergrößert. Die 1–3 mm langen Griffel stehen auf einem konischen Polster. Nach Insektenbestäubung bilden sich längliche bis eiförmige, abgeflachte, gerippte Spaltfrüchte, die in 2 Früchte zerfallen. Jede Einzelfrucht mit 4 geflügelten und bestachelten Rippen. Zur Fruchtzeit schließt sich der Blütenstand nestförmig zusammen.
| Blütenformel: |
| * K5 C5 A5 G(2) unterständig |
Historische Veröffentlichungen
Plinius (ca. 23–79 n. Chr.) führte in seiner Naturgeschichte zwei verschiedene Daucus-Arten auf, die heute als Athamanta cretensis und Peucedanum cervaria gedeutet werden. Hinter seinem als wilde Pastinake bezeichneten Staphylinos wird von einigen die Wilde Möhre vermutet. Ferner erwähnte Plinius eine Pastinaken-Art, die die gallische genannt werde, und bei den Griechen Daucos hieße.
Dioskurides (1. Jh. n. Chr.) beschrieb neben der Wilden Möhre eine weitere Art: Daucus gingidium, die Meeres-Wildkarotte. Das Gingidium, so schrieb er, gleiche der Wilden Möhre und besäße eine leicht bittere, weiße Wurzel, die gekocht oder eingekocht als Gemüse gegessen werde. Sie sei harntreibend und magenfreundlich.
Bedeutung der Artnamen
- carota: lat. carota = Möhre
- sativus: lat. sativus = gesät, bezeichnet Kulturpflanzen
Interessantes am Rande
-
Die Stacheln der Früchte besitzen kleine Widerhaken, sodass sie leicht im Fell von Tieren hängen bleiben, die sie auf diese Weise verbreiten.